Irgendetwas stimmt nicht mit Chinas großer „Fabrik“: Ihr industrieller Rausch schafft keinen wirtschaftlichen Wert und hat ein Verfallsdatum.

Bis vor einigen Jahren, als China als „Fabrik der Welt“ bezeichnet wurde, dachten die meisten Menschen an Produkte wie einfaches Spielzeug mit dem Aufkleber „Made in China“. Heute denken die Menschen bei diesem Begriff nicht mehr nur an verderbliche Plastikprodukte oder sehr billige Kleidung, sondern auch an beeindruckende Elektrofahrzeuge mit Spitzentechnologie oder moderne und erschwingliche Elektronikgeräte, wenn nicht gar an Roboter. Dazwischen liegen enorme Anstrengungen Pekings, die innovativsten Industrien zu fördern . Ziel ist es einerseits, die Abhängigkeit vom Westen zu verringern ( China ist nicht mehr der Hauptabnehmer Deutschlands ) und andererseits, den Anteil am Welthandelskuchen zu dominieren. Obwohl die Fortschritte in diesem Bereich unbestreitbar sind, wie die neue Dynamik des Welthandels zeigt, stimmt etwas nicht mit der chinesischen Fabrik. Trotz der Bemühungen (in Form massiver Investitionen) führt diese Entschlossenheit nicht zur Schaffung wirtschaftlichen Mehrwerts , und die Zeit läuft ab: Peking wird diese Bemühungen nicht mehr lange aufrechterhalten können.
Auf den ersten Blick scheint Chinas Industriepolitik erfolgreich zu sein. Dank Pekings Industriepolitik, insbesondere dem 2015 eingeführten Plan „Made in China 2025“ , wurden große Mengen an Ressourcen in die Förderung inländischer Innovationen und technologischer Autarkie gesteckt, um Chinas Abhängigkeit vom Westen zu verringern. Der Plan umfasst zehn Schlüsselindustrien, darunter Informationstechnologie (IT), Robotik , neue Energien und Biotechnologie .
Zu diesem Zweck hat China seine Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) deutlich erhöht. Während diese Ausgaben 2015 noch 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmachten, stiegen sie bis 2023 bereits auf 2,6 Prozent und näherten sich damit dem OECD-Durchschnitt von 2,7 Prozent an, wie aus einem im Juli veröffentlichten Bericht der Commerzbank hervorgeht. China gab bereits mehr für F&E aus als die EU (2,1 Prozent), aber immer noch weniger als die USA (3,5 Prozent). In absoluten Zahlen, also kaufkraftbereinigt, betrugen Chinas F&E-Ausgaben bereits 95 Prozent der US-Ausgaben. Die EU erreichte dagegen nur 61 Prozent des US-Niveaus.
Aufschlussreich ist auch die Zahl der weltweit angemeldeten Patente : Im Jahr 2022 lag China mit einem Anteil von 27 % bereits vor den USA. Darüber hinaus hat China insbesondere bei Patenten im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien sowie Biotechnologie aufgeholt.
Laut einer Studie des Australian Strategic Policy Institute (ASPI) ist China in 37 der 44 bewerteten Technologien führend und veröffentlicht in Bereichen wie Fertigung und moderne Werkstoffe, künstliche Intelligenz (KI) und Informatik, Energie und Umwelt, Quanteninformatik, Biotechnologie, Verteidigung, Raumfahrt und Robotik oft mehr als fünfmal mehr hochwirksame Forschungsergebnisse als seine nächsten Konkurrenten (Link zum Ranking). Eine weitere Studie der Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) zeigt, dass China bei Elektrofahrzeugen weltweit führend ist und in den Bereichen KI, Robotik und Quanteninformatik knapp an der Weltspitze liegt .
Was läuft also schief ? „Angesichts der massiven Investitionen Chinas in neue Industrien sollten diese Branchen theoretisch besser abschneiden als der Rest der chinesischen Wirtschaft. Dies ist jedoch nicht der Fall. Der Anteil dieser Branchen an der gesamten Wertschöpfung hat sich nicht signifikant erhöht , obwohl ihr Anteil an den Kapitalinvestitionen deutlich zugenommen hat“, erklärt Tommy Wu, leitender Volkswirt bei der Commerzbank, im oben genannten Bericht der deutschen Bank.
Wie Wu erläutert, dürfte die Wertschöpfung, definiert als die Differenz zwischen den Umsätzen eines Unternehmens (Verkaufspreise multipliziert mit den Mengen) und dem Wert der Vorleistungen, am stärksten von sinkenden Verkaufspreisen aufgrund von Überkapazitäten und dem daraus resultierenden ruinösen Wettbewerb betroffen sein. Diese Konzepte sind in letzter Zeit in den Seiten der Finanzpresse vielfach aufgetaucht.
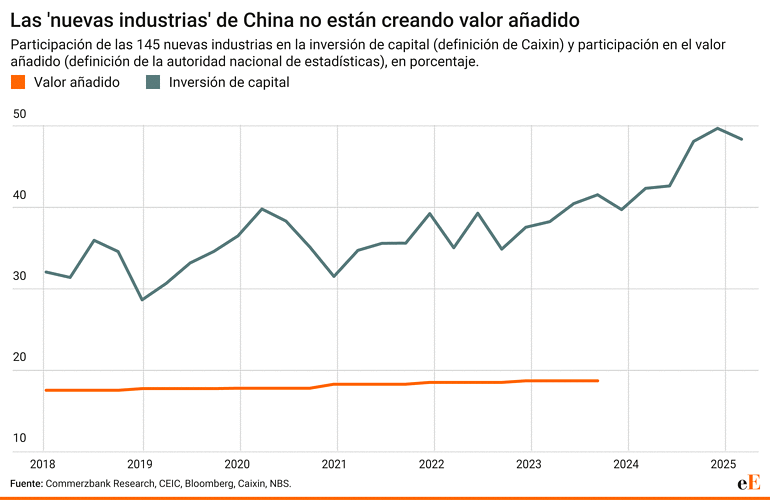
Die Überproduktion ( Überkapazität ) einer durch offizielle Konjunkturprogramme aufgeblähten chinesischen Industrie wird sowohl durch die Bedenken des Westens (ein China , das Regionen wie Europa mit Waren zu Schleuderpreisen überschwemmt und die lokalen Produzenten erdrückt) als auch durch die interne Dynamik in China (inmitten der ständigen Deflationsgefahr , heftiger Preiskämpfe , wie man sie bei Elektroautos sieht, wobei das Referenzunternehmen BYD skandalöse Preisnachlässe ankündigt ) thematisiert.
Dass diese Überkapazitäten entstanden sind , hat viel mit der Rolle der lokalen Regierungen zu tun , betont die Commerzbank. „Da China ein sehr großes Land ist und jede Provinz über unterschiedliche Ressourcen und Kulturen verfügt, delegiert die Zentralregierung in Peking die Umsetzung der Wirtschaftspolitik häufig an die lokalen Regierungen. Diese müssen neben anderen von Peking vorgegebenen politischen Zielen ihre eigenen BIP-Wachstumsziele sowie Innovationsziele erreichen. Um ihre Karriere voranzutreiben, müssen lokale Beamte diese Ziele weitgehend erfüllen. Deshalb fördern sie Unternehmen in neuen Branchen“, erklärt Wu.
Ein recht aufschlussreicher Fall. Wenn beispielsweise jede Kommune einen eigenen Hersteller für Elektrofahrzeuge anstrebt, führt dies zu Überinvestitionen und Überkapazitäten. Dies ist jedoch nicht nur in der Elektrofahrzeugbranche der Fall, sondern in der gesamten Wirtschaft weit verbreitet.
Darüber hinaus müssen die lokalen Regierungen für ausreichende Steuereinnahmen sorgen. Da Mehrwertsteuer und Körperschaftssteuer mehr als 60 Prozent der gesamten Steuereinnahmen ausmachen, können sie es sich nicht leisten, große Steuerzahler zu verlieren . Deshalb fördern sie diese Steuersätze weiterhin, auch wenn die Aussichten auf anständige Gewinne gering sind, fügt Wu hinzu.
Natürlich wird sich diese Situation nicht über Nacht dramatisch ändern . Der Commerzbank-Bericht geht davon aus, dass China seine Industriepolitik mittelfristig (fünf Jahre) fortsetzen wird. „Das liegt daran, dass die Führung nationale Innovation und technologische Autarkie als oberste Priorität betrachtet. Wirtschaftliche Effizienz ist dagegen zweitrangig. China ist bereit, für Innovationen einen Preis in Form von Überkapazitäten, Marktverzerrungen und ruinösem Preiswettbewerb zu zahlen, insbesondere weil es für die Regierung schwierig ist, die Produktion und Preise privater Unternehmen zu kontrollieren und die lokalen Regierungen eng zu lenken“, so Wu.
Langfristig verschärfen sich die Probleme jedoch. „Nach den nächsten fünf Jahren wird es für China zunehmend schwieriger, seine derzeitige Industriepolitik beizubehalten“, so der Analyst der deutschen Bank. Einerseits, so betont er, stiegen die Innovationskosten für neue technologische Durchbrüche, zumal keine unbegrenzten Mittel zur Subventionierung neuer Industrien zur Verfügung stünden. Andererseits sei die Staatsverschuldung bereits deutlich gestiegen (laut der von der Commerzbank verwendeten Messmethode über 120 % des BIP im Jahr 2024) und werde aufgrund des Rückgangs der Erwerbsbevölkerung wahrscheinlich weiter steigen.
eleconomista




